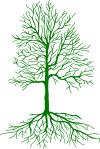Hier wird nur kurz und rudimentär auf die Grundlagen der Physiologie der Bäume eingegangen.
Wünschenswert wäre, ein breiteres Verständnis über die „Funktionsweise“ eines Baumes zu vermitteln.
Dadurch können viele Fehler beim Arbeiten am und um den Baum und somit auch Schäden verhindert werden.
Wurzeln müssen verschiedene Aufgaben erfüllen.
So sind sie verantwortlich für die Verankerung im Boden, sowie für die Nährstoff-, Sauerstoff- und Wasseraufnahme.
Diese Aufgaben werden durch unterschiedliche Wurzeltypen wahrgenommen. So unterscheidet man zwischen Skelettwurzeln und Faserwurzeln. Wie der Stamm oder der Ast unterliegen auch Wurzeln dem sekundären Dickenwachstum. Das heisst, jedes Jahr kommt ein neuer Jahrring hinzu und die Wurzel wird jedes Jahr etwas dicker.
Die Skelettwurzeln haben keine Sorbtionsfähigkeit und können entsprechend weder Wasser noch Nährstoffe aufnehmen. Sie dienen der Verankerung im Boden. Ausserdem dienen sie auch als „Leitungen“ für Wasser und Assimilate, denn am Ende einer aktiven, lebendigen, unversehrten Skelettwurzel findet man in der Regel Faserwurzeln.
Faserwurzeln dienen im Gegensatz zu den Skelettwurzeln der Wasser- und Nährstoffaufnahme. Sie wachsen in der Regel oberflächennah und gehen bis über den Traufbereich der Krone hinaus.
Faserwurzeln wachsen vor allem dorthin, wo es auch etwas zu holen gibt. Das kann, je nach Wasser- oder Nährstoffangebot im Boden, auch weit über den Traufbereich der Krone sein.
Aus Faserwurzeln werden später Skelettwurzeln.
Werden sie durch Abscheren oder Abgraben des Oberbodens entfernt, wird die Aufnahmefähigkeit von Wasser und Nährstoffen beeinträchtigt. Der Baum wird geschädigt. Dies kann massive Auswirkungen auf die Versorgungssituation eines Baumes haben.
Legende:
a) Wurzelanläufe
b1) vertikale Skelettwurzel-Pfahlwurzel
b2) vertikale Skelettwurzel-Senkwurzel
b3) horizontale Skelettwurzel
c1) Endwurzel / Faserwurzel mit beschränktem Wachstum
c2) Verdickte Enwurzel / Faserwurzel
d) Wurzelhaare
Diese Abbildung zeigt den groben Aufbau eines Holzkörpers mit sekundärem Dickenwachstum. Die Abbildung könnte beispielsweise einen Baumstamm, einen Ast in der Krone oder eine Skelettwurzel darstellen.
Dabei sind folgende Gewebearten dargestellt:
Als Rinde wird umgangssprachlich gemeinsam der Bast und die Borke bezeichnet: Das Kambium bildet gegen Innen Holz und gegen Aussen Rinde.
Dieser Tulpenbaum wurde während Bauarbeiten von einem Bagger leicht touchiert. Die Rinde (Bast und Borke) wurde dabei über gut 40% des Stammumfangs abgeschält.
Dieser Schaden wird nicht in nützlicher Frist heilen oder verwachsen. Der Baum läuft die nächsten paar Jahre im Notfallmodus, er wird versuchen, den Schaden zu überwallen. Er wird sich nur schwach entwickeln. Künftige Holzfäulen sind vorprogrammiert.
Kurz gesagt, er wird zu einem „Problembaum“ werden.
Zur Bestimmung des Schadens zählt die Breite der Verletzung (und nicht deren Länge) am Stamm. Denn daraus leitet sich die Beeinträchtigung im Wasser- und Assimilattransport ab. In diesem Fall beträgt die Verletzung 40% des Stammumfangs. Dies entspricht bei einem Tulpenbaum einem Schaden von 100% (gem. Richtlinie zur Schadensberechnung bei Bäumen, BSB).
Der Baum muss ersetzt werden.
Hier wurde infolge von Bauarbeiten an einer Strasse Wurzelraum abgegraben.
Deutlich sichtbar sind Schäden an den Starkwurzeln. Nicht so sichtbar sind die Schäden an den Feinwurzeln.
Das Entfernen von Starkwurzeln in unmittelbarer Stammnähe kann die Standfestigkeit eines Baumes beeinträchtigen. Die Verletzungen an den Wurzeln dienen als Eintrittspforten für Pilze und andere Schadorganismen. Diese beginnen mit der Zersetzung des Holzes. Die Folge sind Fäulen im Wurzelbereich, welche mit der Zeit in Richtung Stamm wandern. Es ist eine Frage der Zeit, bis sich der Pilz am Stamm etabliert hat und diesen zu zersetzen beginnt.
Je näher am Stamm sich die Wunde befindet, desto schneller erreicht die Fäule den Stamm.
Bei den Grabarbeiten wurden neben den Starkwurzeln auch Feinwurzeln verletzt, respektive entfernt.
Diese sind, wie vorgängig beschrieben, verantwortlich für die Wasseraufnahme. Dieser Baum wird künftig Probleme haben, seine Krone mit genügend Wasser zu versorgen.
Erschwerend für den Baum ist zudem sein Standort: Links kommt die Strasse zu liegen, auf der rechten Seite befindet sich ein komplett versiegelter Platz.
Immer häufiger sind Bilder von gekappten Bäumen anzutreffen. Dabei werden die Baumkronen massiv zurückgeschnitten.
Die Folge sind Bäume, bei welchen das während Jahrzehnten fein austarierte Verhältnis zwischen Wurzeln und Krone nicht mehr im Einklang ist. Der Baum beginnt aus schlafenden Knospen auszutreiben, im Bestreben, die verlorene Krone wieder aufzubauen. Solche Bäume werden nie wieder einen arttypischen Habitus erreichen. Die Verkehrssicherheit solcher Bäume muss regelmässig abgeklärt werden, Kosten entstehen.
Vorwiegend trifft man diese Bilder auf privaten Liegenschaften an. Dies führt daher, dass immer öfter fachfremde Firmen und Personen (Facility-Manager und Liegenschaftenbetreuer) mit der Baumpflege betraut werden und Bäume nach Gutdünken zurecht stutzen.
Um solche Schäden, welche man durchaus als „Sachbeschädigungen“ bezeichnen darf, zu vermeiden, sollten nur Fachpersonen mit der Baumpflege beauftragt werden. Auf der Webseite des Bundes Schweizer Baumpfleger sind qualifizierte Firmen nach Gebiet gelistet.